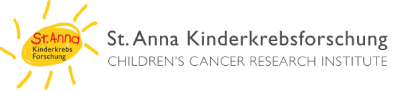IGF-1 als „Zündschlüssel“ für Knochenkrebs: Wiener Forschungsteam entschlüsselt Entstehung des Ewing-Sarkoms
Ein Forschungsteam unter Leitung von Heinrich Kovar, Principal Investigator an der St. Anna Kinderkrebsforschung (St. Anna CCRI) in Wien, hat einen zentralen Mechanismus bei der Entstehung des Ewing-Sarkoms entdeckt. Die im Fachjournal Cell Reports veröffentlichte Studie zeigt, wie das Zusammenspiel eines Krebsfusionsgens mit hormonellen Veränderungen während der Pubertät die Entwicklung dieser aggressiven Krebserkrankung auslöst.
Das Ewing-Sarkom zählt zu den aggressivsten Formen von Knochenkrebs und betrifft hauptsächlich Jugendliche. Trotz intensiver Forschung blieb bislang unklar, warum das charakteristische Krebsfusionsgen EWS::FLI1 allein nicht ausreicht, um die Erkrankung auszulösen.
Die nun im Fachmagazin Cell Reports veröffentlichte Studie zeigt: Erst das Zusammenspiel von EWS::FLI1 mit dem Wachstumshormon IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1) führt zur malignen Transformation embryonaler Knochenvorläuferzellen. „Unsere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass das Ewing-Sarkom möglicherweise schon im Embryonalstadium vorbereitet wird, aber erst durch hormonelle Veränderungen während der Pubertät zur Krebserkrankung wird“, erklärt Studienleiter Heinrich Kovar. „IGF-1 wirkt dabei wie ein Zündschlüssel, der eine zuvor stille Prädisposition in Gang setzt.“
Wie der Tumor „startet“
In präklinischen Mausmodellen gelang es dem Team, den Krankheitsverlauf nachzustellen. Während Knochenzellen mit dem EWS::FLI1-Fusionsgen allein keine Tumoren entwickelten, führte die zusätzliche Exposition gegenüber hohen IGF-1-Spiegeln – vergleichbar mit den Konzentrationen während des menschlichen Pubertätswachstums – zur Entstehung von Tumoren, die in Aussehen und Verhalten dem menschlichen Ewing-Sarkom stark ähnelten.
Eine Schlüsselrolle spielt dabei das Protein YAP1, das durch IGF-1 aktiviert wird und gemeinsam mit TEAD-Transkriptionsfaktoren Gene steuert, die Zellteilung und Überleben fördern. „Es ist wie eine doppelte Absicherung“, so Kovar. „Das Fusionsgen EWS::FLI1 öffnet zwar bestimmte genetische Schalter, aber erst durch die Aktivierung von YAP1 werden sie tatsächlich betätigt.“ Damit wurde erstmals ein zweistufiger Mechanismus beschrieben: Der genetische Krankheitsverursacher EWS::FLI1 muss durch hormonelle Signale in der richtigen Entwicklungsphase verstärkt werden, um eine Tumorbildung auszulösen.
Neue Ansätze für gezielte Therapien
Die Studie geht noch einen Schritt weiter: Im Labor testeten die Forscher*innen Inhibitoren, die entweder den IGF-1-Rezeptor (IGF-1R) oder YAP1/TEAD blockieren. Während Einzelbehandlungen nur begrenzte Effekte zeigten, führte die Kombination beider Ansätze zu einem deutlich besseren Ansprechen der Tumorzellen. „Unsere Ergebnisse legen nahe, dass eine kombinierte Blockade von IGF-1R und YAP1/TEAD ein vielversprechender therapeutischer Ansatz sein könnte, insbesondere für Patientinnen und Patienten, bei denen herkömmliche Therapien nicht mehr wirken“, sagt Kovar.
Zwar existieren bereits Medikamente gegen IGF-1R, sie haben in klinischen Studien bisher nur begrenzten Erfolg gezeigt. Die neue Erkenntnis, dass zusätzlich die YAP1/TEAD-Aktivität gehemmt werden sollte, könnte jedoch erklären, warum frühere Versuche nur teilweise erfolgreich waren – und warum eine Kombinationstherapie künftig bessere Chancen bieten könnte.
Grundlagenforschung mit translationalem Potenzial
Die aktuelle Arbeit ist noch Grundlagenforschung, betont Kovar. Dennoch eröffnen sich daraus konkrete Perspektiven: Zum einen wurde ein zuverlässiges präklinisches Modell geschaffen, mit dem künftige Medikamentenkombinationen effizient getestet werden können. Zum anderen legt die Studie einen Mechanismus offen, der spezifisch angreifbar erscheint und sich von bisherigen Therapieansätzen unterscheidet.
„Wir haben einen sehr grundlegenden Mechanismus identifiziert, der wahrscheinlich bei einem Großteil der Ewing-Sarkome eine Rolle spielt“, so Kovar. „Das eröffnet völlig neue Wege, diese aggressive Erkrankung besser zu verstehen und letztlich auch gezielter zu behandeln.“
Internationale Zusammenarbeit
Neben der St. Anna Kinderkrebsforschung waren auch die Medizinische Universität Wien und das Ludwig-Boltzmann-Institut für Krebsforschung an der Arbeit beteiligt. Die Studie wurde durch Förderungen der Europäischen Union, der Alex’s Lemonade Stand Foundation sowie des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF ermöglicht