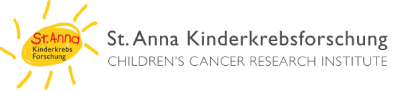30 Prozent Rückfälle bei kindlicher AML: Forscherin sucht neue Schwachstellen bei Blutkrebs
Dieser Artikel behandelt die folgenden Themen:
Was ist AML und warum ist sie so gefährlich?
Heterogene Struktur erschwert Behandlung
Neues Projekt erforscht molekularer Basis
Warum Zinkfinger-Proteine so wichtig sind
Das Ziel: Von der Grundlagenforschung zur Therapie
Der Zinkfinger-Screen: Ein cleveres Experiment erklärt
Was das Überleben der Zellen verrät
Ein Blick in die Zukunft der AML-Behandlung
Jedes dritte Kind mit akuter myeloischer Leukämie erlebt einen Rückfall – ein Problem, das Christina Horstmann von der St. Anna Kinderkrebsforschung mit einem innovativen Ansatz lösen will: Sie untersucht welche Zinkfinger-Proteine eine Rolle in der Krankheitsentwicklung spielen könnten. Dies könnte einen Weg für die Entwicklung neuer Medikamente oder Therapieformen ebnen.
Was ist AML und warum ist sie so gefährlich?
Die akute myeloische Leukämie, kurz AML, ist eine aggressive Form des Blutkrebses, die sowohl Kinder als auch Erwachsene betreffen kann. Bei dieser Erkrankung können sich die sogenannten myeloischen Vorläuferzellen nicht mehr normal weiterentwickeln. Diese Zellen sollten eigentlich zu wichtigen Blutzellen wie weißen Blutkörperchen, roten Blutkörperchen oder Blutplättchen reifen. Stattdessen kommt es zur deren unkontrollierten Vermehrung und Ansammlung im unreifen Zustand, wodurch die die normale Blutbildung gestört wird.
Heterogene Struktur erschwert Behandlung
Insgesamt 15-20 Prozent der an Leukämie erkrankten Kinder sind auf diese aggressive Leukämieform zurückzuführen. Die gute Nachricht: Die Medizin hat in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte bei der Behandlung von AML gemacht. Moderne Therapieansätze haben die Heilungschancen deutlich verbessert. Doch trotz dieser Erfolge erleiden noch immer 30% der betroffenen Kinder Rückfälle.
Die hohe Rückfallrate zeigt, warum die Entwicklung zielgerichteter Therapien so wichtig ist. AML ist eine äußerst heterogene Krankheit, bei der zahlreiche Gene von Mutationen betroffen sind. Dies führt zur Fehlregulation von vielen zellulären Vorgängen. Diese molekulare Vielfalt erschwert eine wirksame Behandlung und verdeutlicht den Bedarf an neuen, zielgerichteten Therapieansätzen. Was bei einem Patienten funktioniert, wirkt bei einem anderen möglicherweise nicht.
Neues Projekt erforscht molekularer Basis
Hier kommt Christina Horstmann ins Spiel. Sie ist PhD-Studentin in der Gruppe von Florian Grebien an der St. Anna Kinderkrebsforschung. In ihrem neuen Projekt widmet sie sich einer besonders interessanten Proteinfamilie: den Zinkfinger-Proteinen. Diese gehören zu einer der größten Proteinfamilien überhaupt und spielen eine wichtige Rolle in einer Vielzahl von zellulären Prozessen.
Der Fokus liegt dabei auf den sogenannten Domänen dieser Proteine. Wenn ein Protein ein Lego-Konstrukt wäre, dann könnte man sich die Domänen als einzelnen Lego-Bausteine vorstellen. Anders gesagt: Eine Domäne ist eine kleine, stabil gefaltete Struktur innerhalb eines Proteins.
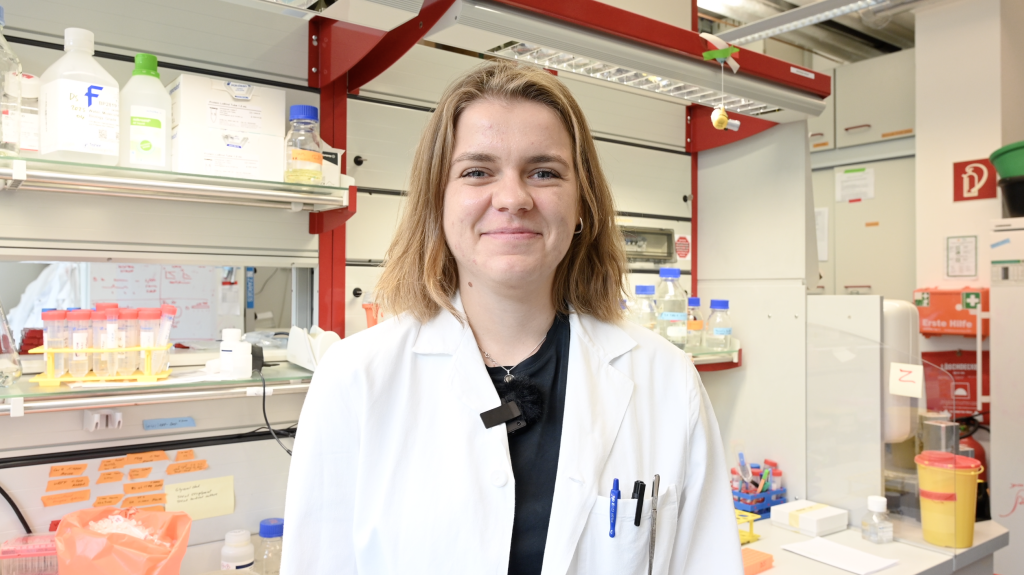
Warum Zinkfinger-Proteine so wichtig sind
Zinkfinger-Proteine sind Multitalente in unseren Zellen. Ihre namensgebenden Zinkfinger-Domänen geben ihnen nicht nur ihre Struktur und Funktion, sondern ermöglichen es ihnen auch, an verschiedenen zellulären Prozessen mitzuwirken. Sie können beispielsweise epigenetische Prozesse regulieren, beim Proteinabbau helfen oder bei der Signalübertragung innerhalb der Zelle eine Rolle spielen.
Wenn diese Prozesse gestört werden, so kann dies zur Entwicklung von AML beitragen. Obwohl bereits bekannt ist, dass Zinkfinger-Proteine eine Rolle bei der AML-Entwicklung spielen, hat sich bisher noch keine Studie gezielt auf die Domänenebene dieser Proteine konzentriert – genau hier setzt das innovative Forschungsprojekt an.
Das Ziel: Von der Grundlagenforschung zur Therapie
Ziel ist es Zinkfinger-Proteine zu identifizieren, deren Domänen eine Schlüsselrolle bei der AML-Entwicklung spielen. Ist dieses Protein einmal gefunden, könnte es als Angriffspunkt für neue Therapien dienen. Diese Herangehensweise ist besonders vielversprechend, da sie das Potenzial hat, gezielt in die Krankheitsentstehung einzugreifen, anstatt nur die Symptome zu behandeln.
Der Zinkfinger-Screen: Ein cleveres Experiment erklärt
Um dies zu erreichen, werden gezielt Gensequenzen verändert, die für bestimmte Proteine oder Domänen kodieren. Man spricht von einem „Knock-out“ oder einer Modifikation. Dafür bringt man eine Bibliothek von spezifischen genetischen Sequenzen in Zellen ein, mit deren Hilfe die Kodierung von Proteinen oder ihren Zinkfinger-Domänen gezielt ausgeschalten werden kann. In einem Screening-Ansatz kann man schließlich herausfinden, ob Zellen durch das Ausschalten von einzelnen Domänen schneller wachsen oder am Wachstum gehindert werden.
Was das Überleben der Zellen verrät
Aus dem Schicksal der Zellen lassen sich wichtige Rückschlüsse ziehen: Welche Proteine oder spezifischer welche Zinkfinger-Domänen sind für das Überleben und Wachstum der Krebszellen verantwortlich? Besonders interessant wird es, wenn die Modifizierung eines Genes dazu geführt hat, dass sich die Krebszelle nicht mehr weiter vermehrt. Diese könnten in Zukunft als therapeutische Angriffspunkte dienen.
Der große Vorteil von diesem Ansatz liegt darin, dass er sehr zielgerichtet ist: Im Gegensatz zu sogenannten Genom-weiten Screens, bei denen sämtliche Gene des Genoms ausgeschaltet werden, konzentriert sich Christina‘s Projekt auf die spezifische Familie der Zinkfinger-Proteine und deren Domänen. Diese fokussierte Herangehensweise soll neue Einblicke auf molekularer Ebene liefern, welche in Zukunft die Entwicklung von zielgerichteten Therapieformen ermöglichen könnten,
Ein Blick in die Zukunft der AML-Behandlung
Dieses Projekt zeigt, wie wichtig es ist, Krebs auf molekularer Ebene zu verstehen. Jede neue Erkenntnis über die Rolle von Proteinen und deren Proteindomänen, wie im Fall der Zinkfinger bringt uns einem Ziel näher: einer Welt, in der auch Kinder mit AML eine gesunde Zukunft haben.