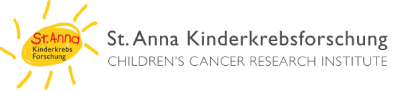Vernetzung als natürliche Folge herausragender Forschung …mit Florian Halbritter
In der modernen Wissenschaft ist Zusammenarbeit der Schlüssel zu Durchbrüchen und Innovationen, besonders in komplexen Forschungsfeldern wie der Krebsgenomik. Florian Halbritter, Leiter der Forschungsgruppe „Entwicklungsbiologie & Krebsgenomik“ an der St. Anna Kinderkrebsforschung, steht mit seiner Arbeit exemplarisch für die Bedeutung dieser interdisziplinären Zusammenarbeit.
Als Bioinformatiker bewegt sich Florian Halbritter mit seinem Team an der Schnittstelle von Biologie, Medizin, Statistik und Informatik. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen ist heute tief in seinem Forschungsansatz verankert. Um dorthin zu gelangen, hat er auf seinem Weg viele verschiedene Eindrücke gesammelt und sich oft als „Außenseiter“ in neuen Forschungsgebieten gefühlt: Als Informatiker unter Stammzellforschern, als Stammzellforscher unter Epigenetikern und Immunologen und jetzt als Epigenetiker unter Krebsforschern. „Ich habe gelernt, mich in dieser Rolle wohlzufühlen, und versuche, neue Themen mit Neugier und Demut anzugehen“, erzählt er im Interview.
Für junge Forschende, die sich unsicher fühlen, wenn es darum geht, ein eigenes Netzwerk aufzubauen, hat Halbritter beruhigende Worte: Er sieht Vernetzung in der Wissenschaft nicht als dezidierte Aufgabe, sondern als etwas, das durch herausragende Arbeit ganz natürlich entsteht. Besonders an der St. Anna Kinderkrebsforschung schätzt er die enge Zusammenarbeit zwischen den Gruppen, die häufig in gemeinsamen internationalen Projekten mündet und damit den Austausch von Wissen und Expertise auf globaler Ebene fördert.
Inwieweit spielen interdisziplinäre Zusammenarbeit und Wissensaustausch in Ihrer Forschung eine Rolle?
Interdisziplinarität ist im Grunde genommen fest in unserem Ansatz verankert. Als Bioinformatiker arbeiten wir an der Schnittstelle von Biologie, Medizin, Statistik und Informatik. Meine Kolleginnen und Kollegen sowie Kooperationspartner stammen aus diesen verschiedenen Bereichen, und unser täglicher Austausch fördert neue Perspektiven und macht die Forschung noch spannender.
Wie hat sich die Bedeutung der Zusammenarbeit aufgrund technologischer Fortschritte verändert?
Dank technologischer Durchbrüche können wir jetzt eine Vielzahl biomolekularer Messungen an denselben Proben durchführen und gleichzeitig viele Proben auf einmal analysieren. Mit all diesen Technologien umzugehen und die resultierenden Datensätze zu analysieren, ist für eine einzelne Person kaum zu bewältigen. Zusammenarbeit ist daher noch wichtiger geworden.
Welche spezifischen Projekte oder Forschungsthemen verbinden Sie und Ihre Forschungsgruppe mit anderen Gruppen innerhalb der St. Anna Kinderkrebsforschung?
Wir arbeiten an fast allen Projekten mit verschiedenen Gruppen der St. Anna Kinderkrebsforschung zusammen. Unser Hauptaugenmerk liegt auf den frühen Entwicklungsstadien von kindlichen Krebserkrankungen. Um diese Stadien zu erforschen und zu modellieren, kombinieren wir unsere analytischen Ansätze mit dem Fachwissen von Spezialisten für verschiedene Arten von Kinderkrebs an der St. Anna Kinderkrebsforschung. Zum Beispiel arbeiten wir an einem großen Projekt über das Ewing-Sarkom zusammen mit Heinrich Kovar und Martin Distel – dieses wird von der amerikanischen Stiftung Alex’s Lemonade Stand Foundation finanziert – oder zusammen mit Sabine Taschner-Mandl an Neuroblastomen.
Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit mit den anderen Gruppen?
Im Laufe meiner Karriere habe ich mich immer wie ein Neuling gefühlt: Als Informatiker unter Stammzellforschern, als Stammzellforscher unter Epigenetikern und Immunologen und jetzt als Epigenetiker unter Krebsforschern. Ich habe gelernt, mich in dieser Rolle wohlzufühlen, und versuche, neue Themen mit Neugier und Demut anzugehen. Das könnte ich nicht alleine schaffen. Die Zusammenarbeit mit anderen Forschungsgruppen, die in völlig anderen Bereichen Experten sind, ermöglicht es uns, effizient in diese neuen Themen einzutauchen und gemeinsam neue Entdeckungen zu machen.
Welche Tipps haben Sie für junge Forscherinnen und Forscher, die gerade erst anfangen, ein Netzwerk aufzubauen? Gibt es Möglichkeiten zum Netzwerken an der St. Anna Kinderkrebsforschung?
Ich würde das Netzwerken nicht unbedingt als eine Aufgabe oder Anforderung betrachten, die erfüllt werden muss. Seien Sie einfach offen für die Einsichten und Beiträge anderer und bieten Sie Ihre eigene Hilfe an, wann immer es möglich ist. Gute Arbeit fördert das Wachstum Ihres Netzwerks auf natürliche Weise. An der St. Anna Kinderkrebsforschung sind Zusammenarbeit und Austausch zwischen den Gruppen weit verbreitet und erstrecken sich oft auch auf internationale Projekte, was zahlreiche Möglichkeiten zur Vernetzung bietet.
Wie würden Sie die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit für den Erfolg Ihrer Forschungsgruppe einschätzen?
Internationale Zusammenarbeit ermöglicht nicht nur einen breiten Wissensaustausch, sondern bündelt auch Ressourcen und Expertise in neuen Technologien. Dadurch wird es möglich, noch komplexere Forschungsfragen zu bearbeiten und den Umfang unserer Untersuchungen zu erweitern. Darüber hinaus erhöht diese Zusammenarbeit die Sichtbarkeit unserer Arbeit auf globaler Ebene und fördert langfristige Partnerschaften, die dazu beitragen, wissenschaftliche Durchbrüche voranzutreiben.
Mit welchen nationalen oder internationalen Forschungseinrichtungen, industriellen Partnern oder Unternehmen arbeiten Sie im Rahmen Ihrer Forschung zusammen? Welche Projekte und wie?
Wir kooperieren häufig mit Forschern anderer Institutionen, sowohl in Österreich als auch weltweit. Beispielsweise arbeiten wir mit den Genomik-Einrichtungen des CeMM und des Vienna Biocenter zusammen, um Zugang zu deren modernsten Technologien zu erhalten, oder mit klinischen Wissenschaftlern und Pathologen der Medizinischen Universität Wien, um Tumorgewebe zu analysieren. International nutzen wir ein Netzwerk von Stammzell- und Entwicklungsbiologen, um verschiedene Arten von Kinderkrebs zu modellieren. So starten wir beispielsweise gerade ein neues Projekt zum Wilms-Tumor, bei dem wir mit dem RIKEN-Institut in Japan zusammenarbeiten.