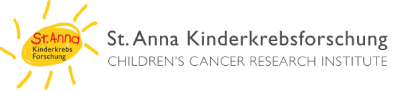Zellkulturen in der Krebsforschung: Ein Blick ins Labor
In dem hellen Labor mit den großen Fensterwänden sitzen drei Forscherinnen, die Hände unter einer Sterilwerkbank. Mit präzisen Griffen setzen sie Filterspitzen auf und transportieren mit einer Pipette scheinbar Flüssigkeiten von einer Petrischale in eine andere. Doch es ist nicht irgendeine „Flüssigkeit“ – es sind Zellkulturen und sie werden gerade gefüttert.
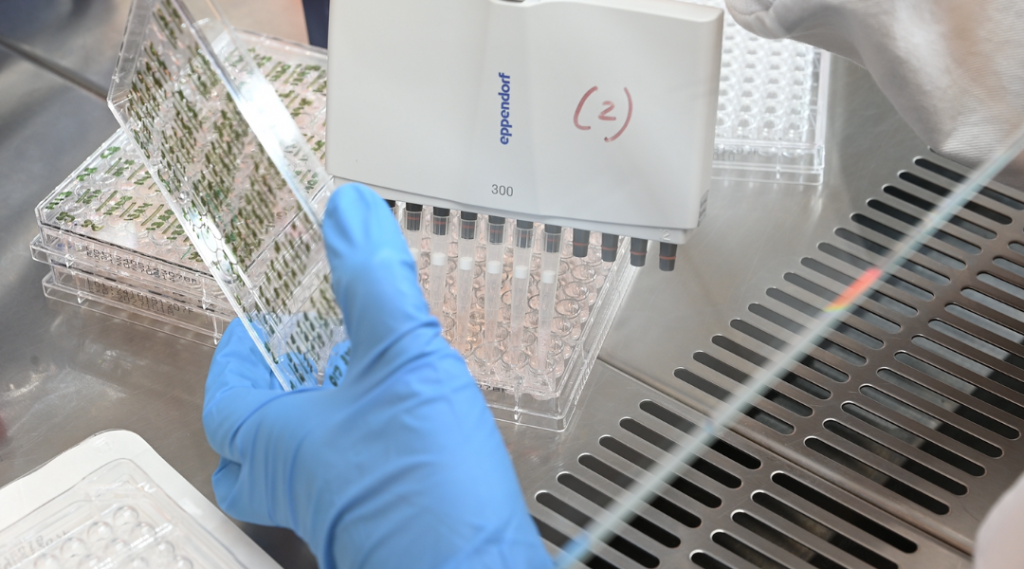
Was sind Zellkulturen?
Zellkulturen sind Zellen, die außerhalb eines lebenden Organismus unter kontrollierten Bedingungen gezüchtet werden. In der Krebsforschung sind das meist verschiedene Krebszellen, die als Basis für viele Experimente dienen: In dem einen Experiment schaltet eine Forscherin beispielsweise bestimmte Proteine in den Zellen aus, um zu sehen, ob sie sich dann immer noch vermehren. Eine andere Forscherin hingegen testet verschiedene Wirkstoffe an den Zellen, um so neue Therapiemöglichkeiten zu finden.
Warum Zellen einen „Hausputz“ brauchen
Zellkulturen wachsen und vermehren sich – das Wuchern ist sogar ein typisches Merkmal von Krebszellen. Das funktioniert aber nur, wenn ausreichend Platz und Nährstoffe vorhanden sind. Andernfalls sterben die Zellen und Abfallstoffe sammeln sich an, was die Gesundheit der noch lebenden Zellen beeinträchtigt. Ähnlich wie bei einem Aquarium wird deshalb regelmäßig das Nährmedium erneuert, um eine gesunde Umgebung zu gewährleisten.
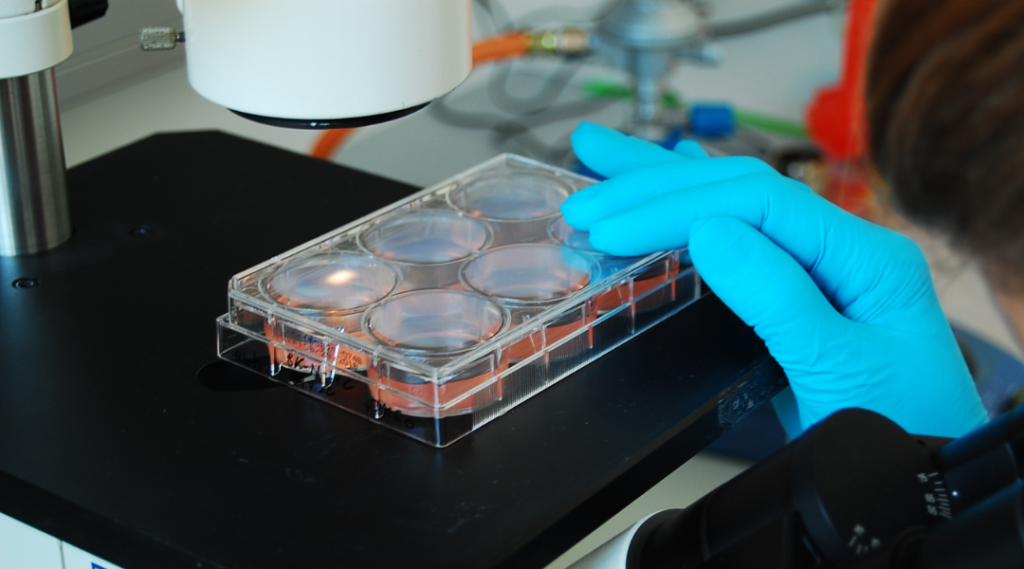
Aus dem Tiefschlaf ins Labor
Wenn die Zellen gerade nicht gebraucht werden, „schlafen“ sie eingefroren in flüssigem Stickstoff oder bei minus 80 Grad Celsius. Hier schützt sie ein spezielles Gefriermedium vor Kälteschäden. Was im Kühlschrank lagert, ist dabei ganz unterschiedlich: Manchmal sind es noch „unberührte“ Zellen für neue Experimente, manchmal aber auch Zellen mitten im Versuch. Diese können nach dem Auftauen genau dort weiterverwendet werden, wo das Experiment unterbrochen wurde.
Vor der Verwendung werden die Zellen zunächst aufgetaut und je nach Experiment in kleine Multiwellplatten und später in größere Kulturschalen überführt. Anschließend wachsen sie bei 37 Grad Celsius in einem Inkubator weiter. Die Forschenden kümmern sich regelmäßig um die Kulturen: Etwa alle zwei Tage werden die Zellen gesplittet und mit frischem Nährmedium versorgt.

Wenn es zu eng wird: Das Splitten
Liegen die Zellen zu dicht aneinander, müssen sie gesplittet werden – also verdünnt und in neue Kulturschalen überführt. Dabei gibt es je nach Zellart verschiedene Vorgehensweisen: Sogenannte Adhärente Zellen haften am Boden der Kulturschale und werden vor dem Splitten mit einem Puffer gewaschen, um tote Zellen zu entfernen. Anschließend werden die lebenden Zellen durch ein Medium und vorsichtiges Pipettieren vom Boden abgelöst.
Suspensionszellen hingegen schwimmen frei im Medium. Tote Zellen entfernen sich hier meist beim regulären Mediumwechsel von selbst. Zeigen jedoch viele Zellen Anzeichen von Stress oder Absterben, wird die Kultur zentrifugiert: Die lebenden Zellen setzen sich dabei am Boden des Röhrchens ab, während tote Zellen im Überstand verbleiben. Beide Zellarten werden nach dem Splitten gezählt, verdünnt und in frischem Medium weiterkultiviert.
Wie überprüft man die Qualität von Zellkulturen?
Zur Kontrolle der Zellvitalität verwenden die Forscher*innen spezielle Färbemethoden. Ein Farbstoff markiert tote Zellen, während lebende ungefärbt bleiben. Mit einem Zählgerät lässt sich anschließend die Anzahl lebender und toter Zellen quantifizieren.
Die Häufigkeit der Pflege hängt übrigens von der Zelllinie ab: Während Stammzellen täglich versorgt werden müssen, reicht es bei den meisten Krebszelllinien alle zwei Tage. Um an Wochenenden nicht ins Labor kommen zu müssen, wird am Freitag oft eine geringere Zellzahl angesetzt – so haben die Zellen mehr Platz und überstehen das Wochenende problemlos.

Wie tragen Zellkulturen zur Entwicklung neuer Medikamente bei?
In unseren Laboren arbeiten die Forscher*innen größtenteils mit Krebszelllinien verwendet. Mit diesen untersuchen sie molekulare Faktoren und Mechanismen, die eine Rolle bei der Krebsentstehung spielen. Zudem testen sie, welchen Einfluss bestimmte Wirkstoffe auf Krebszellen haben.
Die Forscher*innen nutzen dafür oft die „Genschere“ CRISPR-Cas9, um bestimmte Gene auszuschalten. Abhängig vom Experiment ist ein Effekt nach etwa drei Tagen bis zu zwei Wochen sichtbar.
Ähnlich verhält es sich beim Testen verschiedener Medikamente: Je nach Wirkmechanismus kann eine Wirkung bereits nach etwa einer Stunde, in anderen Fällen aber erst nach mehreren Tagen nachgewiesen werden. Größere und langwierigere Experimente sind die sogenannten Screens – dabei lassen die Forscher*innen die Zellen von einer bis zu fünf Wochen lang wachsen, um einen gesamten Effekt zu beobachten.
Noch geduldiger müssen sie sein, wenn sie Zellen resistent gegen ein Medikament machen wollen: Dabei wird die Medikamenten-Konzentration nach und nach erhöht, sodass nur widerstandsfähigste Zellen überleben. Das kann tatsächlich bis zu einem halben Jahr dauern.
Doch davon lassen sich unsere Forscher*innen nicht abschrecken. Sie wissen: ihre Arbeit hilft dabei, Krebs besser zu verstehen und zielgerichtete Therapien mit minimalen Nebenwirkungen zu entwickeln. Was heute in der Zellkultur getestet wird, könnte morgen Leben retten.