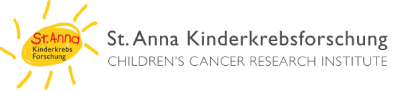Neuroblastom: Neue Kombinationsmethode spürt versteckte Tumorzellen zuverlässig auf
(Wien, 04.09.2025) – Das Neuroblastom ist eine der häufigsten Krebsarten bei Kindern und besonders schwer zu behandeln, wenn winzige Reste von Tumorzellen nach der Therapie unentdeckt durch den Körper zirkulieren. Bisher übersehen herkömmliche Untersuchungsmethoden etwa 60% dieser Zellreste, was zu Rückfällen führt. Eine neue internationale Studie zeigt nun: Kombiniert man drei moderne Verfahren, so können diese versteckten Tumorzellen viel zuverlässiger aufgespürt werden. Das könnte die Behandlung und Heilungschancen betroffener Kinder erheblich verbessern.
Was ist Neuroblastom und was macht es gefährlich?
Das Neuroblastom ist der häufigste solide Tumor außerhalb des Gehirns bei Kindern. Die Überlebenschancen der kleinen Patient*innen hängen stark davon ab, wie risikoreich ihre Erkrankung eingestuft wird: Bei mehr als 90% der Hochrisiko-Patient*innen haben sich die Tumorzellen bereits bei der ersten Diagnose ins Knochenmark ausgebreitet. Noch problematischer: Der Großteil wiederkehrender Erkrankungen entsteht aus Tumorzellen, die im Knochenmark „schlummern“ – oft aus einem Zellverband, der schon bei der ersten Diagnose da war, aber unentdeckt blieb.
Warum bleiben gefährliche Krebszellen unentdeckt?
Eines der größten Probleme bei der Neuroblastom-Behandlung ist das Aufspüren der sogenannten „minimalen Resterkrankung“ – winzige Mengen von Tumorzellen, die nach der Behandlung im Körper verbleiben. Diese können durch moderne Untersuchungsmethoden aufgespürt werden, bei denen Körperflüssigkeiten wie Knochenmarkproben analysiert werden (sogenannte „Liquid Biopsies“ oder Flüssigbiopsien). Diese Verfahren sind schonender für die kleinen Patient*innen und ermöglichen eine häufigere Überwachung der Krankheit.
Was funktioniert an den bisherigen Methoden nicht?
Die herkömmlichen Untersuchungsverfahren arbeiten wie folgt: Zunächst werden Knochenmarkausstriche eingefärbt und unter dem Mikroskop betrachtet. Zusätzlich werden Gewebeproben aus dem Knochenmark auf Tumorzellen untersucht. Diese traditionellen Methoden führten jedoch zu einem alarmierenden Problem: Etwa 60% der Patient*innen, die nach den herkömmlichen Untersuchungen als krebsfrei galten, erleiden einen Rückfall.
Der Grund: Die bisherigen Methoden sind nicht empfindlich genug, können nicht alle Zelltypen erkennen und übersehen wichtige molekulare Eigenschaften der Tumorzellen. Besonders problematisch ist, dass Neuroblastom-Zellen ihren Charakter ändern können, welche möglicherweise andere Therapieansätze benötigen.
Wie funktioniert die neue kombinierte Methode?
In der internationalen Studie wurde eine Kombination aus drei hochmodernen Verfahren getestet, die sich perfekt ergänzen:
- Automatische Immunfluoreszenz plus iFISH Analyse (AIPF): Mit dieser Methode werden Tumorzellen mit bestimmten Farbstoffen sichtbar gemacht und automatisiert erkannt. Selbst einzelne Tumorzellen unter Millionen gesunder Zellen können so aufgespürt werden. Wenn dabei nur sehr wenige Zellen gefunden werden, wird anschließend ein Verfahren namens iFISH angewandt. Dieses prüft die gefundenen Zellen auf genetische Veränderungen, die typisch für das Neuroblastom sind.
Wichtig ist auch, dass mit dieser Methode untersucht werden kann, ob und wieviel von dem Molekül GD2 auf Tumorzellen gefunden wird, da Patient*innen mit Hoch-risiko-Neuroblastom eine gegen GD2 gerichtete Immuntherapie erhalten.
- Molekulare Analyse für adrenerge Zellen: Diese hochempfindliche Methode erkennt spezielle Marker von Tumorzellen im Knochenmark und ist besonders gut darin, sehr geringe Mengen von Tumorzellen aufzuspüren.
- Molekulare Analyse für mesenchymale Zellen: Diese Methode identifiziert die bisher noch nicht gut erforschten, aber möglicherweise behandlungsresistenten mesenchymalen Neuroblastom-Zellen, die von den anderen Verfahren übersehen werden könnten.
Kombinierte Methode findet versteckte Tumorzellreste verlässlicher
Zusammen mit einem internationalen Team untersuchte Sabine Taschner-Mandl 509 Knochenmarkproben von 108 Hochrisiko-Neuroblastom-Patient*innen aus Zentren in Österreich und den Niederlanden. Dabei zeigte sie, dass die kombinierte Methode deutlich mehr Fälle mit versteckten Krebszellen erkannte als die herkömmlichen Verfahren. Besonders die molekulare Analyse für adrenerge Zellen zusammen mit der AIPF-Methode erwies sich als außerordentlich empfindlich für das Aufspüren geringer Tumorzellmengen, während die AIPF-Methode zusätzlich wertvolle zusätzliche Informationen über mögliche Angriffspunkte für Immuntherapien lieferte.
Probenentnahme könnten optimiert werden
Die Studie lieferte eine weitere wichtige Erkenntnis: Bei der Erstdiagnose lässt sich typischerweise eine hohe Anzahl von Tumorzellen nachweisen, und zwar meist im Knochenmark auf beiden untersuchten Seiten. Bei versteckten Tumorzellresten während und nach der Behandlung ist dagegen häufiger nur eine Seite betroffen. Entsprechend könnte es künftig ausreichen, die Knochenmarkprobe bei der Erstdiagnose nur einseitig zu entnehmen. Eine beidseitige Entnahme wäre für die Nachsorge reserviert, wenn sich nur noch sehr wenige Tumorzellen im Knochenmark befinden. Das reduziert die Patientenbelastung.
Lässt sich die neue Methode als Standardverfahren einsetzen?
Ein entscheidender Aspekt der Studie war außerdem die Bewertung, ob sich die hochempfindlichen Untersuchungsverfahren im Vergleich zu den bisherigen Standard-Methoden auch in der Praxis bewähren. Die Ergebnisse zeigen: Es ist machbar, diese modernen Techniken mit den herkömmlichen Untersuchungen zu kombinieren und das sogar in einem internationalen Netzwerk verschiedener Kliniken. Besonders beeindruckend ist, dass die hochempfindlichen Analysen bereits aus sehr kleinen Knochenmarkproben zuverlässige Ergebnisse liefern.
Was bedeutet das für betroffene Patient*innen?
Die neuen Methoden ermöglichen es, das Voranschreiten der Krankheit und Rückfälle früher zu erkennen. Dadurch können Ärzt*inne rechtzeitig eingreifen und die Behandlung individuell anpassen. Zusätzlich können Veränderungen der Tumorzellen und potenzielle Angriffspunkte für Immuntherapien überwacht werden, was dabei hilft Therapieresistenzen und mögliche Rückfälle besser zu verstehen.
Die Studie zeigt außerdem, dass die kombinierten hochempfindlichen Untersuchungsverfahren machbar und effektiv sind, auch wenn sie in verschiedenen Ländern und Krankenhäusern angewendet werden. Das ebnet den Weg für standardisierte und präzisere Untersuchungen weltweit.
Insgesamt könnten diese Fortschritte die Behandlungsergebnisse für Kinder mit Neuroblastom erheblich verbessern, indem sie maßgeschneiderte Behandlungsstrategien und frühere Interventionen ermöglichen. Für betroffene Familien bedeutet dies: bessere Überwachung, präzisere Behandlung und letztendlich größere Hoffnung auf Heilung.
Publication
Gelineau, N.U., Bozsaky, E., van Zogchel, L.M.J. et al. Sensitive detection of minimal residual disease and immunotherapy targets by multi-modal bone marrow analysis in high-risk neuroblastoma – a multi-center study. J Exp Clin Cancer Res 44, 224 (2025). https://doi.org/10.1186/s13046-025-03481-w